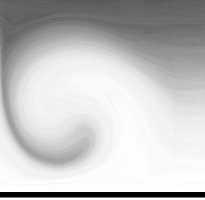

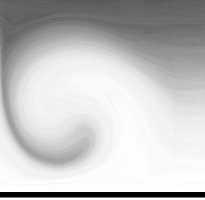

Ich bin bald schon drei Wochen als Gaststudent am IIT Bombay in Mumbai, Indien und habe mich ganz gut eingelebt. Eine andere Gaststudentin, selbst Inderin, hat mich als bereits 93 % indisch bezeichnet… Aber bevor wirklich alltägliche Routine einkehrt berichte ich lieber mal, wie hier eine typische Tag für mich abläuft.
 Meine Uhr weckt mich piepsend um 8:15 (Indian Standard Time, in Deutschland ist es dann noch dreiviertel vier in der Nacht), außer Dienstag, da gehts eine Stunde früher los. Zum Frühstück geht es in die Mensa („mess“), die hier dem Wohnheim („hostel“) angegliedert ist, also entweder vier Stockwerke runter, aus dem B-Block raus, in den B-Block rein, dort in den Keller und von da dann zur Mensa, deren Dach aus der der Zufahrtsstraße besteht, wie man vom Fenster meines Flures aus gut erkennt.
Meine Uhr weckt mich piepsend um 8:15 (Indian Standard Time, in Deutschland ist es dann noch dreiviertel vier in der Nacht), außer Dienstag, da gehts eine Stunde früher los. Zum Frühstück geht es in die Mensa („mess“), die hier dem Wohnheim („hostel“) angegliedert ist, also entweder vier Stockwerke runter, aus dem B-Block raus, in den B-Block rein, dort in den Keller und von da dann zur Mensa, deren Dach aus der der Zufahrtsstraße besteht, wie man vom Fenster meines Flures aus gut erkennt.
Das Frühstück besteht entweder aus indischem Essen, also vegetarisch und nicht süß, oder vier Scheiben Toastbrot mit immer der gleichen einen Marmelade, Butter und zwei Bananen. Ich habe zwar nichts gegen das indische Essen, aber Frühstück muss bei mir süß sein, also bleibts für mich beim Toast. Dazu gibt es Chai-Tee, also Tee, bei dem Milch und Zucker gleich mitgekocht werden – durchaus lecker.
Anschließend geht es nochmal aufs Zimmer zum Zähne putzen (mit Wasser aus der Flasche) und Rucksack packen. Der Campus ist recht groß und mein Wohnheim am äußersten Ende, so dass ich zum Informatik-Gebäude mit meinem gebrauchten Hercules-Fahrrad, ohne Gangschaltung, fahre, das ich für 2000 ₹ (35 €) auf dem Campus erworben habe. Ich bin noch ein bisschen feilsch-faul so dass ich hier vermutlich mehr gezahlt habe als nötig. Da man hier nicht mit kurzen Hosen herumläuft, habe ich mir bei einem Schneider mit 2 m²-Verschlag eine Hose nähen lassen. Auch hier habe ich nicht gefeilscht, aber bei 550 ₹ inklusive Stoff schien mir das auch nicht nötig.
Die Vorlesungen vormittags, von denen ich zwei habe, dauern eine Stunde und finden dreimal die Woche statt, nachmittags, hier habe ich eine Vorlesung, sind es 90 Minuten, dafür zweimal die Woche, also ganz wie bei uns. Auch sonst ist der Unterschied bisher nicht gravierend – manche Professoren benutzen die Tafel, mache haben Folien. Manchmal gibt es Material zur Vorlesungen, manchmal nur das, was man selbst mitschreibt und ein genereller Verweis auf ein Buch zum Thema. Die Studenten beteiligen sich auch hier ein bisschen an den Vorlesungen, etwa mit Fragen, und auch hier scheinen die Professoren das zu begrüßen.
Allerdings scheinen sich hier die Professoren, mehr als in Deutschland, für ihre Studenten verantwortlich zu fühlen. Das hat zweierlei Folgen. Zum einen gibt es öfter mal kurze Tests („quizzes“), manchmal sogar unangekündigt, Übungsaufgaben für zu Hause („assignments“) und pro Semester zwei Prüfungen („mid term“ und „end term“). Andere Professoren überprüfen die Anwesenheit der Studenten und machen einen bestimmten Anteil, etwa 80 oder 90 Prozent, zur Bedingung für das Bestehen des Kurses – das machen meine zum Glück nicht. So stellen sie sicher dass man gar nicht drum herum kommt, sich mit dem Stoff zu beschäftigen. In Deutschland gibt es zwar auch Übungsaufgaben, aber die sind nicht immer verpflichtend und wer sich abhängen lässt, ist auf sich allein gestellt.
Zum anderen sind die Professoren hier sehr erreichbar und engagiert. Einer hat seine Sprechstundenzeiten als 24/7 angegeben und uns seine Handy-Telefonnummer gegeben. Der Dekan der Fakultät nimmt sich einmal die Woche Zeit für mich (einen Gaststudenten, der nicht mal hier einen Abschluss machen wird), damit ich eine Vorlesung, die eigentlich im Herbst angeboten wird, als „self-study course“ machen kann. Das heißt dass ich mich alleine in das Zeug einlese und dann einmal pro Woche eine Art Seminarvortrag halte, über den dann Diskutiert wird. Auch wurde mir erzählt dass Prüfungstermine durchaus mal für 40 Studenten auf Samstag in der früh verschoben werden, weil ein oder zwei Studenten am geplanten Termin nicht können.
Zwischen den beiden vormittäglichen Vorlesungen habe ich eine Stunde frei. In dieser Zeit setze ich mich auf eine Bank vor dem Gebäude, trinke ein, zwei oder auch drei Tässchen (naja, Pappbecherchen) Chai-Tee für jeweils 6 ₹ (10 ¢) und lese die Zeit, dessen Abo ich mir hierher schicken lasse, oder ein Buch. Montags spaziere ich zum Postamt und schicke eine Postkarte an meine Freundin, von denen bisher keine einzige angekommen ist.
 Mittags geht es dann wieder zurück in meinen hostel, um in der Mensa Mittag zu essen. Das sieht dann meist wie auf dem Bild rechts aus: Reis mit zweierlei vegetarischen Soßen und Fladenbrot, Gurken und etwas aus Jogurt oder Milch, was manchmal sauer und manchmal süß ist. Die Soßen wechseln täglich, sehen aber fast gleich aus, so dass es jeden Tag eine Überraschung ist, wie sie schmecken und ob sie zu scharf sind. Letzteres ist die Ausnahme, wenn man nicht sich nicht gerade beim Schild „spicy food“ bedient. Das Brot reiße ich in kleiner Stücke, mit denen ich dann den mit Soße versetzten Reis aufnehme und esse. Allerdings reicht das Brot selten für den ganzen Reis, so dass ich den Rest mit dem Löffel esse. Messer oder Gabel gibt es nicht und brauche ich auch nicht.
Mittags geht es dann wieder zurück in meinen hostel, um in der Mensa Mittag zu essen. Das sieht dann meist wie auf dem Bild rechts aus: Reis mit zweierlei vegetarischen Soßen und Fladenbrot, Gurken und etwas aus Jogurt oder Milch, was manchmal sauer und manchmal süß ist. Die Soßen wechseln täglich, sehen aber fast gleich aus, so dass es jeden Tag eine Überraschung ist, wie sie schmecken und ob sie zu scharf sind. Letzteres ist die Ausnahme, wenn man nicht sich nicht gerade beim Schild „spicy food“ bedient. Das Brot reiße ich in kleiner Stücke, mit denen ich dann den mit Soße versetzten Reis aufnehme und esse. Allerdings reicht das Brot selten für den ganzen Reis, so dass ich den Rest mit dem Löffel esse. Messer oder Gabel gibt es nicht und brauche ich auch nicht.
Das Abendessen, von halb acht bis halb zehn, läuft genau so ab. Dazwischen gibt es von halb fünf bis sechs Uhr noch „tiffin“, eine auch meist salzige Zwischenmahlzeit, oft mit Teig in frittierter und gefüllter Form, zu der es wieder unbegrenzt Chai-Tee gibt . Bei jeder Mahlzeit laufe ich an einem großen Ständer vorbei, in dem für jeden Bewohner ein Karte steckt. Diese gebe ich ab und bekomme dafür das Tablett, dass ich dann selbst befülle und nach dem Essen auf einen Stapel stelle. Bezahlt wurde die Mensa im voraus und es werden alle Mahlzeiten berechnet, auch wenn ich nicht erscheine – die Karte dient nur dazu zu vermeiden, dass Gäste kostenlos oder Bewohner mehrfach essen.
Ab elf Uhr abends gibt es dann die “night cantine” mit leckerem indischen und chinesischem Essen á la carte, frisch gepressten Säften und ähnlichem. Leider hat mich meine Arbeitslast noch nicht dazu gebracht, regelmäßig so lange aufzubleiben, um davon Gebrauch machen zu können.
 Je nach Wochentag schaue ich und die anderen deutschen Austauschstudenten noch bei der Deutschklasse vorbei, in der eine deutsche Lehrerin ein paar Studenten beibringt, wann es der, dem, die oder das heißt, und assistiere ein wenig. An anderen Tagen lasse ich mich in einem winzigen Barbiersalon in einer kleinen Gasse rasieren. Ich habe zwar mein Rasierapperat dabei, aber das ist eine gute Gelegenheit aus dem Campus herauszukommen und mit „normalen“ Indern ins Gespräch zu kommen – auch wenn das nicht sehr gut klappt, da dort Englisch oft nicht gut gesprochen wird. Und es ist recht entspannend, sich eine knappe halbe Stunde lang in einen Stuhl zu hocken und nichts tun zu müssen. Der Spaß kostet mich lediglich 25 ₹ (40 ¢). Auf dem Rückweg esse ich vielleicht noch eine der leckeren indischen Süßspeißen, ein wohl frittiertes Teigbällchen, für 6 ₹ in einer kleinen Bude am Straßenrand, oder ich nehme mir einen Packen Wasser in Flaschen mit – es gibt zwar Wasseraufbereitungsgeräte im Wohnheim, aber hier gehe ich noch auf Nummer sicher.
Je nach Wochentag schaue ich und die anderen deutschen Austauschstudenten noch bei der Deutschklasse vorbei, in der eine deutsche Lehrerin ein paar Studenten beibringt, wann es der, dem, die oder das heißt, und assistiere ein wenig. An anderen Tagen lasse ich mich in einem winzigen Barbiersalon in einer kleinen Gasse rasieren. Ich habe zwar mein Rasierapperat dabei, aber das ist eine gute Gelegenheit aus dem Campus herauszukommen und mit „normalen“ Indern ins Gespräch zu kommen – auch wenn das nicht sehr gut klappt, da dort Englisch oft nicht gut gesprochen wird. Und es ist recht entspannend, sich eine knappe halbe Stunde lang in einen Stuhl zu hocken und nichts tun zu müssen. Der Spaß kostet mich lediglich 25 ₹ (40 ¢). Auf dem Rückweg esse ich vielleicht noch eine der leckeren indischen Süßspeißen, ein wohl frittiertes Teigbällchen, für 6 ₹ in einer kleinen Bude am Straßenrand, oder ich nehme mir einen Packen Wasser in Flaschen mit – es gibt zwar Wasseraufbereitungsgeräte im Wohnheim, aber hier gehe ich noch auf Nummer sicher.
 Wenn wir noch etwas unternehmen, etwa in einer der Filialen amerikanischer Pizzaketten essen zu gehen, wie es die Inderin in unserer Gruppe so gerne macht, fahren wir meist mit einer Auto-Rickshaw in das ebenfalls an den Campus angrenzende Viertel Hirandandani Gardens. So eine Fahrt kostet 10 bis 20 ₹ und ist damit billiger als viele weniger aufregende Achterbahnen in Deutschland. Das Viertel selbst ist eine gehobenere Gegend, in der man für Pizza oder Klamotten auch nicht wesentlich weniger ausgeben muss als in Deutschland. Ein schönes Leinenhemd hat mich dabei 600 ₹ gekostet, leider ist es gleich bei der ersten Wäsche eingegangen. Apropos Wäsche: Diese packe ich in einen Eimer, trage ihn in den Erdgeschoss, gebe sie beim Wäscher ab, der sie für 10 ₹ in einer seiner Maschinen wäscht und trocknet, und auch für wenige Rupien bügeln würde, und das an sieben Tage die Woche. Meist ist sie am gleichen Tag noch fertig, deswegen gibt es von mir stets 2 ₹ extra – ich hoffe das freut ihn.
Wenn wir noch etwas unternehmen, etwa in einer der Filialen amerikanischer Pizzaketten essen zu gehen, wie es die Inderin in unserer Gruppe so gerne macht, fahren wir meist mit einer Auto-Rickshaw in das ebenfalls an den Campus angrenzende Viertel Hirandandani Gardens. So eine Fahrt kostet 10 bis 20 ₹ und ist damit billiger als viele weniger aufregende Achterbahnen in Deutschland. Das Viertel selbst ist eine gehobenere Gegend, in der man für Pizza oder Klamotten auch nicht wesentlich weniger ausgeben muss als in Deutschland. Ein schönes Leinenhemd hat mich dabei 600 ₹ gekostet, leider ist es gleich bei der ersten Wäsche eingegangen. Apropos Wäsche: Diese packe ich in einen Eimer, trage ihn in den Erdgeschoss, gebe sie beim Wäscher ab, der sie für 10 ₹ in einer seiner Maschinen wäscht und trocknet, und auch für wenige Rupien bügeln würde, und das an sieben Tage die Woche. Meist ist sie am gleichen Tag noch fertig, deswegen gibt es von mir stets 2 ₹ extra – ich hoffe das freut ihn.
Es ist nicht jede Dienstleistung derart billig. Ich hatte gehofft, mich hier günstig Massieren zu lassen, um meinem Rücken etwas gutes zu tun (der weder das harte Bett noch den unergonomischen Stuhl in meinem Zimmer besonders gut verträgt). Also bin ich eines Tages mal in ein sogenanntes „spa“ gelaufen und habe gefragt, was ich denn für eine Rückenmassage zu zahlen hätte. Der genannte Preis von 2000 ₹ für eine halbe Stunde war keineswegs was ich mir erhofft habe, das zahlt man ja in Deutschland, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber ich wollte mir ein bisschen Luxus gönnen und stimmte zu. Ich wurde in einen anderen Raum geführt, in dem neben zwei Frisörstühlen noch eine mit Leder bezogene Liege stand. Die Masseurin fragte dann, ob ich lieber in einem anderen Raum massiert werden möchte – „more privacy“ – müsste dafür aber 3000 ₹ zahlen. Das war es mir absolut nicht wert und es stört mich ja nicht, wenn da noch andere Leute durchlaufen; es brauchte aber eine Weile bis die Masseurin das verstand. Die Massage selbst wäre vielleicht ganz ok gewesen, wenn das ein richtiger Massagetisch mit einem Loch für den Kopf wäre, aber statt dessen war da ein fest angebrachtes Leder-„Kissen“, so dass ich entweder auf dem Mund lag oder meinen Hals verdrehen musste – alles in allem war das ganze ein rechter Reinfall. Aber das gehört natürlich dazu. Und ich hätte wohl nach dem „menu“, also einer Angebotstafel mit Preisen, fragen sollen, denn der Preis liegt deutlich über dem üblichen, per Internet recherchierten Niveau von ~1000 ₹ für eine solche Massage.
Mir wurde empfohlen mal beim Barbier eine Kopfmassage machen zu lassen. Die ist mit 50 ₹ günstig und sei sehr effektiv (wenn auch ziemlich roh). Letzten Sonntag wollte ich das, bekam aber wegen einem Missverständnisses eine Gesichtsmassage, die aber durchaus auch entspannend war. Und vielleicht gibt es ja auch bezahlbare, gute Massagen…
Ganz teuer wird es wenn man tanzen gehen möchte (was bei mir jetzt nicht zwingend der Fall ist). Dazu muss man meist in Hotels mit gehobenem Niveau gehen, zahlt 1000 ₹ oder mehr für den Eintritt (bekommt dafür aber auch Verzehrcoupons) und löhnt dann 350 ₹ für ein Bier. Gestern haben das ein paar aus unserer Gruppe mal probiert, ich bin wegen eines verstimmten Darms zu hause geblieben und habe das auch nicht bereut. Interessant ist dass man in viele solcher Clubs nur als Pärchen reinkommt oder als Single deutlich mehr eintritt bezahlt. In Deutschland geht man ja insbesondere feiern, um Leute kennen zu lernen, hier muss man Leute kennen lernen um feiern zu gehen…
Vor dem Wohnheim ist ein Badminton-Feld aufgebaut und von fünf Uhr abends bis Mitternacht spielt eigentlich immer jemand, so dass ich regelmäßig dazustoße und ein paar Spiele mitspiele. Einem richtigen „club“, etwa für Basketball wie ich es mal vorhatte, brauche ich daher nicht beitreten um ein wenig Sport machen zu können.
Abends endet der Tag meist mit einer Videokonferenz mit meiner Freundin, bis dann um Punkt Mitternacht die Verbindung von den Wohnheimszimmern ins Internet gekappt wird, ich mich noch dusche (mit kaltem Wasser, warmes gibt es nur an einem Wasserhahn, mit dem man sich einen Eimer füllen und diesen mitnehmen kann – dafür bin ich zu faul) und mich auf der recht harten Mattratze schlafen lege.
Have something to say? You can post a comment by sending an e-Mail to me at <mail@joachim-breitner.de>, and I will include it here.